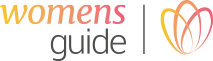Vaterschaftsurlaub & Individualbesteuerung: wichtige Schritte in die richtige Richtung
September 21, 2020
Ressourcenorientiertes Coaching: lebe deine Stärken
Oktober 5, 2020Zu diesem Thema findest du
14 Podcast
Heiraten: Ja oder Nein?
Gast: Jennifer Rickenbach, Anwältin
Dauer: 33:28
Die Eheschliessungen in der Schweiz waren in den letzten 50 Jahren stark rückläufig. Während vor 1965 die zusammengefasste Erstheiratsziffer aufzeigt, dass mehr als 90% der Männer und Frauen eine Erstheirat eingegangen sind, sind es heute noch zwischen 50 – 60%. Zu erkennen ist auch, dass die Scheidungsziffer ab ca. 1965 stark angestiegen ist; von ca. 12% auf ca. 40% (2018). Wenn das so bleibt, wird also nur etwa die Hälfte der Bevölkerung noch heiraten und 2 von 5 Ehen werden zukünftig geschieden.
Warum entscheiden sich immer mehr Paare nicht zu heiraten und was bedeutet das Eingehen einer Ehe in der heutigen Zeit überhaupt?
Eine Eheschliessung hält für die Ehepartner/innen verschiedene Änderungen bereit – von ganz kleinen wie vielleicht das Tragen eines Eherings als Zeichen der Verbundenheit bis zu viel folgereicheren, wie beispielsweise
- einer anderen Besteuerungsgrundlage und Erbschaftsregelung
- dass das Sorgerecht/die Sorgepflicht für gemeinsame Kinder «automatisch» der Mutter und dem Vater zugeteilt wird
- dass der Mietvertrag der gemeinsam bewohnten Wohnung nur dann gekündigt werden kann, wenn beide Ehepartner das Einverständnis geben (auch wenn der Mietvertrag nur auf einen Namen lautet)
Es wäre zu umfassend, auf alle Konsequenzen, die das Eingehen einer Ehe mit sich bringt, einzugehen. Im vorliegenden Blogartikel wollen wir den Fokus darauf legen, welche wirtschaftlichen Folgen eine Eheschliessung/der gewählte Güterstand haben und worüber es sich lohnt im Vorfeld Gedanken zu machen, um die Entscheidung bewusst und informiert zu treffen und sich Überraschungen zu ersparen – egal, ob man ein Leben lang verheiratet bleibt, es zur Scheidung kommt oder der Partner/die Partnerin verstirbt. Ganz nach dem Motto «Vorsicht ist besser als Nachsicht».
Im vorliegenden Blogeintrag erfährst du
… welche Arten von Güterständen es in der Schweiz gibt
… welches die Eigenheiten der verschiedenen Güterstände sind
… was ein Ehevertrag ist und was darin geregelt werden kann
… was ein Konkubinatsvertrag ist und was darin geregelt werden kann
Wenn man in der Schweiz heiratet, kann man sich als Paar zwischen 3 Arten von Güterständen entscheiden:
- Errungenschaftsbeteiligung
- Gütergemeinschaft
- Gütertrennung
Der Güterstand legt fest:
- wie die Ehegatten ihre Vermögenswerte während der Ehe nutzen und verwalten
- wie Vermögen und Schulden bei Scheidung oder Tod aufgeteilt werden
- wie ein Vermögenszuwachs aufzuteilen ist
Wird nichts entscheiden, gilt automatisch der Güterstand der «Errungenschaftsbeteiligung». Was bedeutet das?
Errungenschaftsbeteiligung
In der Errungenschaftsbeteiligung gibt es 4 «Arten» von Gütermassen:

Definition Eigengut
- Güter, die ein Ehegatte in die Ehe einbringt, erbt oder während der Ehe als persönliches Geschenk bekommt (z. B. persönliches Sparguthaben vor Eheschliessung, ein Auto oder eine Eigentumswohnung, die vor der Eheschliessung gekauft wurde)
- persönliche Gegenstände (z.B. Schmuck)
- Genugtuungsansprüche
- Ersatzanschaffungen für Eigengut
Das Eigengut wird jeweils separat verwaltet und hat keinen Einfluss bei der Auflösung des Güterstandes.
Schulden
Grundsätzlich haftet ein Ehegatte nur für seine eigenen Schulden und mit seinem gesamten Vermögen. Schulden können also wie Eigengut betrachtet werden. Eine Ausnahme gilt, wenn die Ehepartnerin/der Ehepartner mit der Verpflichtung einverstanden war oder es sich um Ausgaben für den täglichen Bedarf handelte (z. B. Schulden gemacht wurden, um die Miete oder die Autoversicherung zu bezahlen).
Definition Errungenschaft
Im Umkehrschluss ist alles, was nicht Eigengut ist, Errungenschaft; sprich die während der Ehe gemachten Ersparnisse (z.B. Gehalt, Zinsen, Beiträge in eine 3. Säule), auch Erträge, die aus dem Eigengut entstehen (z.B. die Zinsen eines Bankkontos, welches der Errungenschaft zuzuordnen ist).
Bei der Auflösung des Güterstandes (Scheidung, Tod, neuer Güterstand) wird die Errungenschaft zwischen den Eheleuten je zur Hälfte geteilt.
Beispiel einer Auflösung

Frau nach Auflösung: 300’000 CHF + 150’000 CHF = 450’000 CHF
Mann nach Auflösung: 100’000 CHF + 150’000 CHF = 250’000 CHF
Gütergemeinschaft
Alternativ kann man sich auch für die Gütergemeinschaft entscheiden. Diese Entscheidung muss aktiv gefällt werden und muss in einem Ehevertrag festgehalten werden. In der Gütergemeinschaft gibt es während der Ehe 3 «Arten» von Gütermassen.

Bei der Gütergemeinschaft gibt es drei Varianten: allgemeine Gütergemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft sowie Ausschlussgemeinschaft. Der Einfachheit halber wird nachfolgend nur die allgemeine Gütergemeinschaft dargestellt.
Definition Gesamtgut
- beinhaltet Vermögen und Einkommen der Eheleute mit Ausnahme der Gegenstände, die von Gesetzes wegen (z.B. persönliche Gegenstände) oder durch Definition im Ehevertrag als Eigengut gelten. (Wichtig: das Eigengut ist im Falle einer Gütergemeinschaft kleiner als bei der Errungenschaftsbeteiligung, denn auch das persönliche Sparguthaben, das der Ehepartner/die Ehepartnerin vor der Eheschliessung besass, fliesst ins Gesamtgut ein, ausser es wird vertraglich anders festgehalten. Das ist der Hauptunterschied zur Errungenschaftsbeteiligung, bei der nur die Vermögenswerte, die ab dem Zeitpunkt der Eheschliessung erwirtschaftet werden, beiden gehört.)
- es gehört beiden ungeteilt
Schulden
Je nach Art der Schulden haftet die Ehefrau bzw. der Ehemann entweder
- nur mit «seiner»/«ihrer» Hälfte des Gesamtgutes und mit dem eigenen Eigengut (dies z.B. bei Schulden, die für den persönlichen Bedarf getätigt und im Nichtwissen des anderen Ehepartners gemacht werden) oder aber
- mit dem ganzen Gesamtgut und «seinem»/«ihrem» Eigengut (insbesondere bei Schulden, die für alltägliche Bedürfnisse gemacht werden, wird mit dem ganzen Gesamtgut und dem Eigengut gehaftet)
Das Gesamtgut wird gemeinsam verwaltet und wird im Falle der Auflösung des Güterstandes zwischen Ehefrau und Ehemann aufgeteilt.
Beispiel einer Auflösung

Frau nach Auflösung: 150’000 CHF + 225’000 CHF = 375’000 CHF
Mann nach Auflösung: 100’000 CHF + 225’000 CHF = 325’000 CHF
Hier ist das Eigengut der Frau im Vergleich zum Beispiel unter Errungenschaftsbeteiligung auf 150’000 CHF geschrumpft und die Differenz ist ins Gesamtgut geflossen. In diesem konkreten Beispiel führt dies dazu, dass die Frau bei der Auflösung mit 75’000 CHF weniger ausgeht als bei unter Errungenschaftsbeteiligung.
Gütertrennung
Als dritte Option kann sich das Ehepaar für die Gütertrennung entscheiden. Auch diese Entscheidung muss in einem Ehevertrag festgehalten werden. Bei der Gütertrennung gibt es 2 Vermögen:

Bei diesem Güterstand werden die Ehegatten wie ein unverheiratetes Paar behandelt. Das heisst:
- es gibt keine gemeinsamen Güter und auch Schulden werden nicht «geteilt»
- Ehefrau und Ehemann bleiben Eigentümerin bzw. Eigentümer der eigenen Güter und verwalten sie selbst
Entsprechend gibt es bei der Auflösung des Güterstandes nichts aufzuteilen.
Beispiel einer Auflösung

Frau nach Beendigung des Güterstandes: 300’000 CHF
Mann nach Beendigung des Güterstandes: 100’000 CHF
Ehevertrag
In einem Ehevertrag können die Ehepartner/innen die vom Gesetzgeber vorgegebenen Regelungen in einem bestimmten Mass ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Durch einen Ehevertrag werden diese Anpassungen geregelt. Ein Ehevertrag muss von einem Notar bzw. einer öffentlichen Urkundsperson öffentlich beurkundet werden (einen Link zur einer Vertragsvorlage der Stadt Zürich findest du am Schluss des Artikels unter «Informiere dich weiter»).
Mit Hilfe eines Ehevertrags kann der Güterstand geändert werden:
- wie beschrieben kann im Ehevertrag in der Schweiz eine Gütergemeinschaft oder Gütertrennung vereinbart werden
- es kann der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung beibehalten und nur einzelne Aspekte anders geregelt werden; z.B.
- Festhalten der Eigengüter jedes Ehegatten
- Erklärung der Vermögenswerte als Eigengut, die für die Ausübung des Berufs oder den Betrieb und Erhalt eines Unternehmens benötigt werden. Dazu gehören beispielsweise die Stammanteile einer GmbH, deren Geschäfte ein/e Ehepartner/in führt. Eine solche Erklärung zu «Eigengut» sichert die Existenz des Unternehmens, weil der/die geschäftsführende Ehegatte/Ehegattin das Unternehmen nicht als «Errungenschaft» teilen muss. Wäre das Unternehmen der Errungenschaft zuzuordnen und besteht der/die andere Ehepartner/in auf seinen güterrechtlichen Anspruch am Unternehmen, kann dies im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Deshalb ist es ratsam, dass Unternehmer/innen einen Ehevertrag abschliessen.
- Vereinbarungen, dass die Erträge aus dem Eigengut im Eigengut verbleiben und nicht in die Errungenschaft fallen
- Verzicht oder Abänderung der Mehrwertbeteiligung
- Vereinbarung einer anderen als die hälftige Teilung der Errungenschaft
- Einräumung des Wohnrechtes, der Nutzniessung zu Gunsten des/der Ehegatten/Ehegattin
Durch den Abschluss eines Ehevertrags kann auch Einfluss auf das Erbe genommen werden. Mithilfe eines Ehevertrags kann der überlebende Ehegatte abgesichert werden (im Mass wie es das Gesetz zulässt).
Ein Klassiker ist, dass ein Ehepaar einen Grossteil des gemeinsam angesparten Vermögens in ein Eigenheim investiert hat. Ist dem so, lohnt es sich, in einem Ehevertrag zu regeln, dass beim Tod des Ehegatten/der Ehegattin die gesamte Errungenschaft auf den überlebenden Partner/die überlebende Partnerin übergeht. Ist dies nicht der Fall und die Hälfte der Errungenschaft des/der Verstorbenen fällt in seinen Nachlass und muss mit den Nachkommen geteilt werden, kann das für den Witwer/die Witwe bedeuten, dass er/sie das eheliche Heim verkaufen muss, um die Erben auszubezahlen.
Und welche Möglichkeiten gibt es etwas zu regeln, wenn nicht geheiratet wird?
Konkubinat
Heterosexuelle Paare, die nicht heiraten wollen oder homosexuelle Paare, die sich nicht eintragen lassen (es besteht die Möglichkeit einer «eingetragenen Partnerschaft») aber sich absichern wollen, können einen Konkubinatsvertrag eingehen.
Der Konkubinatsvertrag ist im Gesetz nicht geregelt. Es ist sinnvoll, diesen in schriftlicher Form zu erstellen. Für seine Gültigkeit muss er nur dann von einem Notar oder einer öffentlichen Urkundsperson öffentlich beurkundet werden, wenn zusätzlich erbvertragliche Anordnungen darin enthalten sind.
Folgende Punkte sollten sinnvollerweise in einem Konkubinatsvertrag geregelt werden:
- Inventarliste: was gehört wem?
- bei Hauskauf: kaufen wir die Liegenschaft im Miteigentum?
- gemeinsame Wohnung: wer bleibt nach der Trennung in der gemeinsamen Wohnung und welche Kündigungsfristen gelten?
- Aufteilung der Haushaltskosten
- Unterhaltsbeiträge
- Aufteilung Vermögen
- Abgeltung von Einbussen bei der AHV- und Pensionskasse
- Todesfall: wird eine Todesfall-Risiko-Versicherung abgeschlossen, in der die Partnerin bzw. der Partner begünstigt wird?
- Kinder: wer hat das Sorgerecht, wie wird die Betreuung geregelt und wie werden die Unterhaltsbeiträge geregelt (insb. bei Auflösung des Konkubinats)
Solltest du bald heiraten oder bist bereits verheiratet, lohnt es sich auf jeden Fall mit deinem/deiner Ehepartner/in die Möglichkeit, einen Ehevertrag aufzusetzen, zu besprechen. Dieser Artikel ist kein Plädoyer für oder gegen die Heirat, dass soll und darf jede/r zum Glück selbst entscheiden. Uns ist es jedoch ein Anliegen, dass du diesen Entscheid informiert und bewusst triffst und wir dich mit diesem Blogartikel auf mögliche Vorteile eines Ehevertrages und andere Stolpersteine aufmerksam machen konnten.
Informiere dich weiter bei
Mustervorlage von Eheverträgen je nach Modell: www.myright.ch/de/rechtstipps/partnerschaft-familie/wie-wird-ein-ehevertrag-richtig-aufgesetzt
FAQ Ehevertrag Schweiz: https://www.familienrechtsinfo.ch/eherecht/ehevertrag/
Quellen
Bundesamt für Statistik: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/heiraten-eingetragene-partnerschaften-scheidungen/heiratshaeufigkeit.html, abgerufen am 25. Juli 2020.
ch.ch. Wirtschaftliche Folgen der Ehe – Güterstand: www.ch.ch/de/guterstand/, abgerufen am 25. Juli 2020.
Familienrechtsinfo: www.familienrechtsinfo.ch/eherecht, abgerufen am 25. Juli 2020.
Informationen zum ehelichen Güterrecht in der Schweiz: www.ehegueterrecht.ch, abgerufen am 25. Juli 2020.