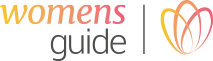Endless Power: wenn Frauen in einer Männerdomäne brillieren
Oktober 12, 2020Technologie Branche: warum es mehr Frauen braucht
November 2, 2020Zu diesem Thema findest du
17 Podcast
Klimakrise: wie du Teil der Lösung sein kannst
Gast: Susanna Niederer, Inhaberin Klimahandlung
Dauer: 52:36
«Es ist so leicht, mit der Veränderung der Welt anzufangen. Trotzdem wäre es eine Revolution, wenn wir es endlich alle täten.»
Jane Goodall
Weshalb tun wir uns mit der Klimakrise so schwer?
Gastbeitrag von Susanna Niederer
In der Schweiz ist der Grossteil der Bevölkerung besorgt über den Klimawandel. Das Thema wird jedoch noch mehrheitlich verdrängt und das in einem bildungsstarken Land, in dem Umweltschutz und -forschung eine lange Tradition haben. Dank des grossen Engagements der Jugendlichen von Klimastreik Schweiz, von Leuten aller Generationen und von verschiedenen Organisationen wird der Klimawandel allmählich Diskussionsstoff am Mittagstisch, in den Sitzungszimmern, in Medien und Politik. Die Frage, was in Bezug auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen erreicht werden sollte, ist einfach zu beantworten: Netto-Null und das schnellstmöglich. Denn um die globale Klimaerwärmung unter 1.5 °C zu halten, dürften weltweit nur noch 430 Gigatonnen CO2 emittiert werden. Ohne griffige Massnahmen wäre dieses Budget jedoch innerhalb der nächsten 9 Jahre aufgebraucht. Deshalb muss auf einen steilen Absenkungspfad eingelenkt werden, um allerspätestens 2050 das Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen. Eine 1.5 °C Temperaturüberschreitung würde gemäss dem IPCC Bericht vom Oktober 2018 katastrophale Konsequenzen für Gesellschaft und Umwelt mit sich bringen [1]. Taten sind gefragt, oder wie es der Journalist und Buchautor Marcel Hänggi formuliert: «Man rettet die Welt nicht, indem man beschliesst, sie dürfe nicht untergehen» [2].
Die tückischen Herausforderungen
Wie das Ziel der Emissionsreduktion zu erreichen ist, ist ein tückisches Problem, und zwar aus folgenden Gründen: Es besteht unvollständiges Wissen über die Wechselwirkungen und Reaktionen einzelner Subsysteme des globalen Klimasystems (wie Erdatmosphäre, Hydrosphäre etc.) im Hinblick auf Rückkopplungseffekte und Kipppunkte. Tückisch auch, weil Ursachen und Wirkungen mehrfach und stark miteinander verknüpft sind und somit Kettenreaktionen auslösen. Wenn beispielsweise Wälder aufgrund sommerlicher Trockenheit ganz oder partiell absterben, hat das negative Folgen auf den CO2-Haushalt, die Schädlingsverbreitung und die Biodiversität, wie auch für die Nutzbarkeit des Waldes. Eine weitere Konsequenz ist Bodenerosion, was auch die Wasserqualität mindert, wenn das Material in die Gewässer gelangt. Kumulierte Herausforderungen dieser Art, für die es keine linearen Lösungen gibt, bringen die menschliche kognitive Kapazität an ihre Grenzen.
Klimaschutz erfordert globale Massnahmen, d. h. eine internationale Beteiligung von diversen AkteurInnen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Die Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Individuums mögen angesichts des globalen Problems als verschwindend gering erscheinen, was die Motivation hemmen kann. Zudem tun sich Menschen mit Veränderungen ihrer Lebensgewohnheiten tendenziell schwer. Solche Veränderungen bergen immer auch Risiken, weil sie die persönliche und soziale Identität tangieren. So werden Werte und Verhalten von der Familie und vom Freundeskreis grösstenteils übernommen, denn die soziale Zugehörigkeit bietet Sicherheit. Da Klimaschutz- massnahmen keine unmittelbare und lokale Wirkung auf das Klima haben, ist die Motivation der Kurzfristigdenkenden, ihr Verhalten zu ändern, gering. Apathie oder Ignoranz sind aber keine brauchbaren Strategien, um der Klimakrise mit ihren verhängnisvollen Folgen entgegen zu treten. «Man muss überzeugt sein, dass man etwas ändern kann. Sonst wird man fatalistisch.» sagt Philippe Thalmann von der EPFL [3].
Die Schaffung von Handlungsspielräumen
Die Klimabewegung demonstriert, dass Handlungsspielräume geschaffen und Erfolge erzielt werden können, trotz zäher Barrieren. Die dadurch ausgelöste Dynamik ermutigt, sich zu mobilisieren. In ungeahnter Weise wird dadurch die Solidarität und Zusammenarbeit genährt. AkteurInnen verschiedener Altersgruppen fühlen sich durch die Klimaarbeit lokal und global verbunden und dadurch Teil eines grossen verantwortlichen Ganzen. Diese Handlungsermächtigung hat mit Autonomie, Eingebundensein und Kompetenz zu tun. Entscheidungen müssen auf den eigenen Interessen und Werten beruhen. Es ist zentral, diese mit anderen Menschen zu teilen, denen man sich nahe und verbunden fühlt. In Gruppen zu arbeiten ist dann wirksam, wenn diese als «effektive Entität» wahrgenommen werden. Die Teilnehmenden müssen sich mit ihren Kompetenzen wirksam eingeben können und durch die kollektiven Handlungen bestimmte Ziele erreichen. Viele der Klima- Engagierten bestätigen, dass sie sich durch die Gruppenarbeit inspiriert, gestärkt und weniger verzweifelt fühlen, gerade angesichts der Klimakrise, die bei vielen Angst, Trauer, Ohnmacht und Wut auslöst.
Persönliche und gesellschaftliche Transformation
Zu realisieren, wie dringlich die Klimakrise ist, hat bei vielen Menschen eine Transformation auf der persönlichen Ebene ausgelöst und dadurch ihre Weltanschauung und Lebensweise verändert. Die Forderung nach «System Change not Climate Change» (übersetzt: Systemveränderung und nicht Klimawandel) wird nicht nur auf der Strasse laut, sondern auf der politischen Bühne und im institutionellen Rahmen allmählich ernsthaft diskutiert. Da es zunehmend unwahrscheinlicher wird, die globale Erderwärmung unter 1.5 °C zu beschränken, bedarf es einer grundlegenden Veränderung. Gesellschaftliche und individuelle Werte, soziale Normen, Beziehungen und Prozesse, die die Grundlage des Zusammenlebens formen, müssen neu überdacht werden. Sich der eigenen Überforderung und Angst zu stellen und sich als Teil des lebensermöglichenden Ökosystems zu erkennen, mag eine gute Basis sein, um an Visionen einer ungewissen und klimaveränderten Zukunft mitzuarbeiten.
Susanna Niederer ist Inhaberin der KlimaHandlung. Sie arbeitete im Bereich Anpassung an den Klimawandel für den öffentlichen Dienst und mit dem Resilience by Design Lab der Royal Roads Universität in Kanada. Auch führt sie KlimaDialoge an Schulen durch. Mehr Informationen zu Susanna und ihrer Arbeit findest du hier:
Filmtipps
Kiss the Ground: Ein Film der einfache Lösungen aufzeigt und uns wieder Hoffnung gibt, wie wir einen Beitrag leisten können, um mit und nicht gegen unsere Erde zu arbeiten. Dabei steht eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion im Zentrum des Filmes. Falls er dich interessiert, findest du hier den Trailer: www.kisstheground.com
Tomorrow: Ein weiterer Must-See-Movie ist der Film von einem jungen Filmteam, welches um die ganze Welt reist und Personen dokumentiert, welche auf ihre Art und Weise einen wichtigen Beitrag zur Umwelt leisten, von Permakultur über Urban Gardening ist alles dabei. Aber Achtung der Enthusiasmus ist ansteckend ;-): Hier gehts zum Trailer: www.tomorrow-derfilm.de
Quellen
[1] IPCC Sonderbericht (2018). 1.5 °C globale Erwärmung (SR1.5), www.de-ipcc.de/256.php
[2] Hänggi, M. (2018). Null Öl. Null Gas. Null Kohle. Wie Klimapolitik funktioniert. Ein Vorschlag. Rotpunktverlag Zürich
[3] Thalmann, P. (2017). Beobachter. Warum handeln wir nicht?www.beobachter.ch/umwelt/klimawandel-warum- handeln-wir-nicht